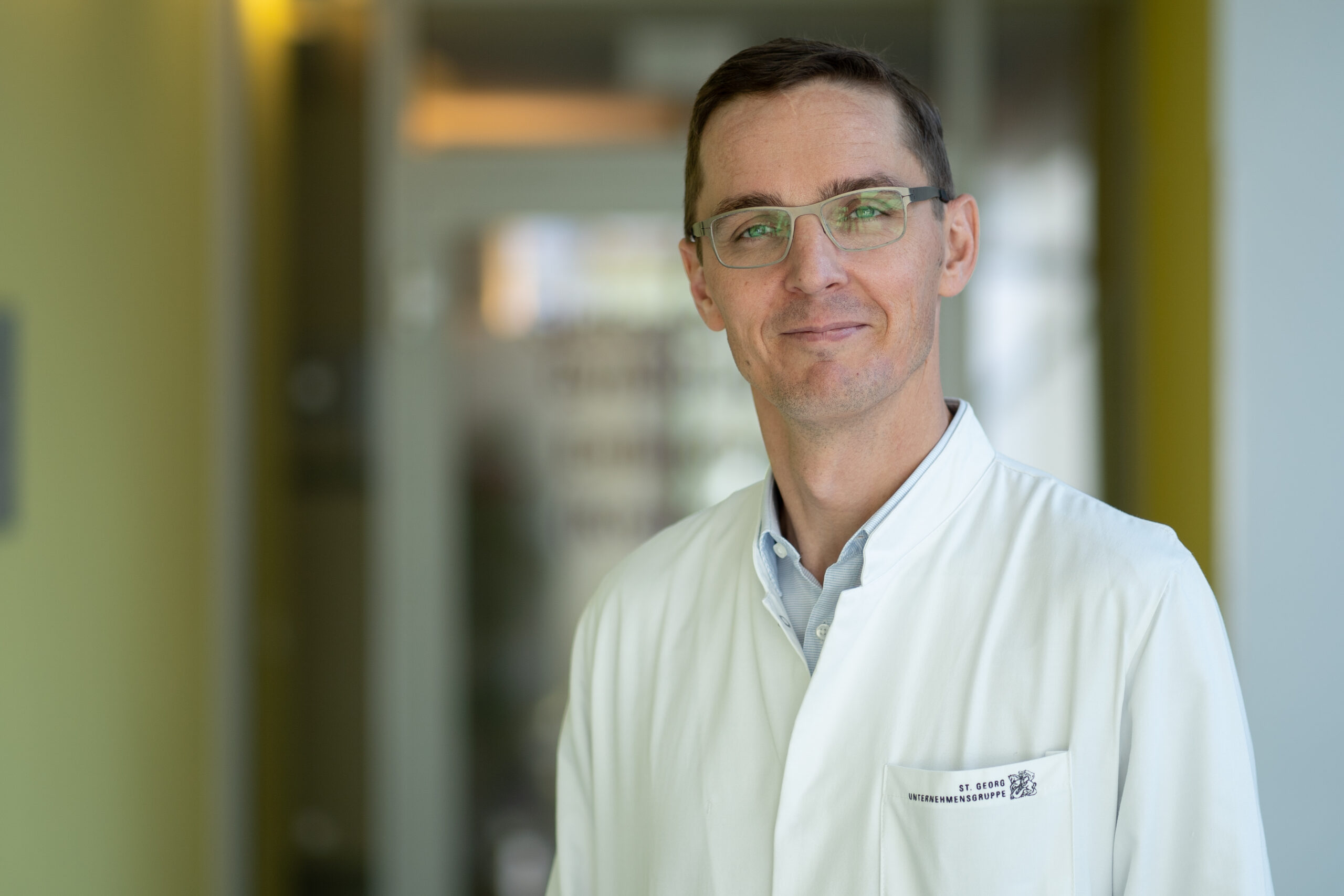Neue Kraft für den Alltag
Wenn Medikamente nicht mehr wirken oder Beschwerden zunehmen, stößt die ambulante Behandlung oft an ihre Grenzen. Die Parkinson-Komplextherapie am Klinikum St. Georg setzt genau dort an – intensiv, individuell und interdisziplinär. Wir haben mit Privatdozent Dr. med. Torsten Kraya und Jan Bergau von der Klinik für Neurologie über das Angebot gesprochen – und über neue Hoffnung für Patienten und ihre Angehörigen.
Was genau ist die Parkinson-Krankheit und wie äußert sie sich?
Jan Bergau: Parkinson ist eine fortschreitende Erkrankung des Nervensystems, bei der es zum Untergang von Nervenzellen im Gehirn kommt. Insbesondere sind hier auch Nervenzellen betroffen, die den Botenstoff Dopamin produzieren – fehlt er, kommt es zu typischen Symptomen wie Muskelsteifheit, Zittern und Problemen mit der Körperhaltung. Viele Betroffene haben Schwierigkeiten beim Gehen oder beim Halten des Gleichgewichts.
Im Klinikum St. Georg bieten Sie die Parkinson-Komplextherapie an. Was genau versteht man darunter?
Dr. Torsten Kraya: Die Komplextherapie ist ein ganzheitlicher Ansatz, der neben der medikamentösen Behandlung auch Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und psychologische Unterstützung umfasst. Sie ist besonders hilfreich, wenn Medikamente nicht mehr ausreichend wirken oder die Symptome stark schwanken. Bei vielen Patienten, die zu uns kommen, wurde die medikamentöse Therapie lange nicht angepasst – mit deutlichen Auswirkungen auf ihre Selbstständigkeit.
Jan Bergau: Parkinson betrifft oft auch Sprache, Kognition und das emotionale Wohlbefinden. In der Therapie arbeiten Logopäden vor allem an der Sprachverständlichkeit, Ergotherapeuten fördern die Selbstständigkeit im Alltag, und Psychologen helfen bei depressiven Verstimmungen oder Ängsten. Physiotherapeuten verbessern unter anderem den Gang und die Beweglichkeit. So werden alle Aspekte der Erkrankung berücksichtigt.
Die Parkinson-Komplextherapie ist eine Kombination verschiedener Therapiebereiche:
- Medikamentöse Therapie: Optimierung der medikamentösen Behandlung
- Physiotherapie: Verbesserung der Beweglichkeit, des Gangbildes, der Koordination und der Körperhaltung sowie Sturzprophylaxe
- Ergotherapie: Förderung der Feinmotorik, Koordination und Bewältigung alltäglicher Aufgaben
- Logopädie: Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen
- Neuropsychologie: Analyse der kognitiven Störungen wie Gedächtnis- oder Aufmerksamkeitsdefizite
- Verhaltenstherapie: Psychoedukation und Gespräche mit dem Ziel, den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern und Begleiterkrankungen zu behandeln.
Wie lange dauert die Komplextherapie?
Jan Bergau: In der Regel zwei Wochen, bei Bedarf aber auch länger. Währenddessen beobachten wir die Patienten engmaschig und passen die Therapie kontinuierlich an. Danach übernehmen meist die niedergelassenen Neurologen die weitere Betreuung.
Welche Voraussetzungen müssen Patienten erfüllen, um an der Parkinson-Komplextherapie teilzunehmen?
Jan Bergau: Um an der Parkinson-Komplextherapie teilzunehmen, muss bereits eine Parkinson-Diagnose gestellt worden sein. Auch ist die Abgrenzung atypischer Parkinsonsyndrome möglich. Zudem ist eine Bereitschaft erforderlich, mindestens zwei Wochen stationär für eine umfassende Therapie aufgenommen zu werden. Weiterhin benötigen Patienten einen Überweisungsschein vom Hausarzt oder dem behandelnden Neurologen.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel für einen Behandlungserfolg nennen?
Dr. Torsten Kraya: Manche Patienten sind stark in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Sie können sich im Bett kaum drehen oder aufrichten. Durch die intensive Therapie und die Anpassung der Medikamente können wir oft erstaunliche Verbesserungen erzielen. Mitunter können Patienten, die zuvor bettlägerig waren, nach zwei Wochen wieder selbstständig gehen und sich eigenständig versorgen. Dieser Gewinn an Selbstständigkeit ist für die Betroffenen enorm wichtig.
Welche Rolle spielen die Angehörigen im Behandlungsprozess?
Jan Bergau: Die Angehörigen spielen eine zentrale Rolle. Sie sind oft die ersten, die Veränderungen bemerken oder sogar den Verdacht auf Parkinson äußern. Zudem unterstützen oder pflegen sie die Patienten im Alltag und sind ein wichtiger Ansprechpartner für uns. Wir beziehen sie aktiv in die Therapie ein, informieren sie über den Umgang mit der Erkrankung und bieten Unterstützung an.
Was wünschen Sie sich für die zukünftige Versorgung von Parkinson-Patienten?
Jan Bergau: Wir wünschen uns eine flächendeckende und gut vernetzte Versorgung, die den Bedürfnissen der Patienten in allen Stadien der Erkrankung gerecht wird. Dazu gehört eine verbesserte Kommunikation zwischen niedergelassenen Ärzten und Kliniken, insbesondere auch in ländlichen Regionen, wo die Wege oft weit sind.
Dr. Torsten Kraya: Ein wichtiges Anliegen ist der Aufbau eines Parkinson-Netzwerks in und um Leipzig, um die Zusammenarbeit zu stärken und Patienten gezielt an Spezialisten zu vermitteln. Perspektivisch möchten wir auch ambulante Behandlungen am Klinikum anbieten und mehr Plätze in der Komplextherapie schaffen, um die Versorgung zu verbessern und niedergelassene Kollegen zu entlasten. Darüber hinaus ist es uns wichtig, Patienten und Angehörige umfassend zu informieren. ■
Hinweis für Fachkreise:
Niedergelassene Neurologen – besonders im ländlichen Raum – sind herzlich eingeladen, sich dem geplanten Parkinson-Netzwerk anzuschließen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei PD Dr. Torsten Kraya. (Telefon: 0341 909-3701; Mail: torsten.kraya@sanktgeorg.de)