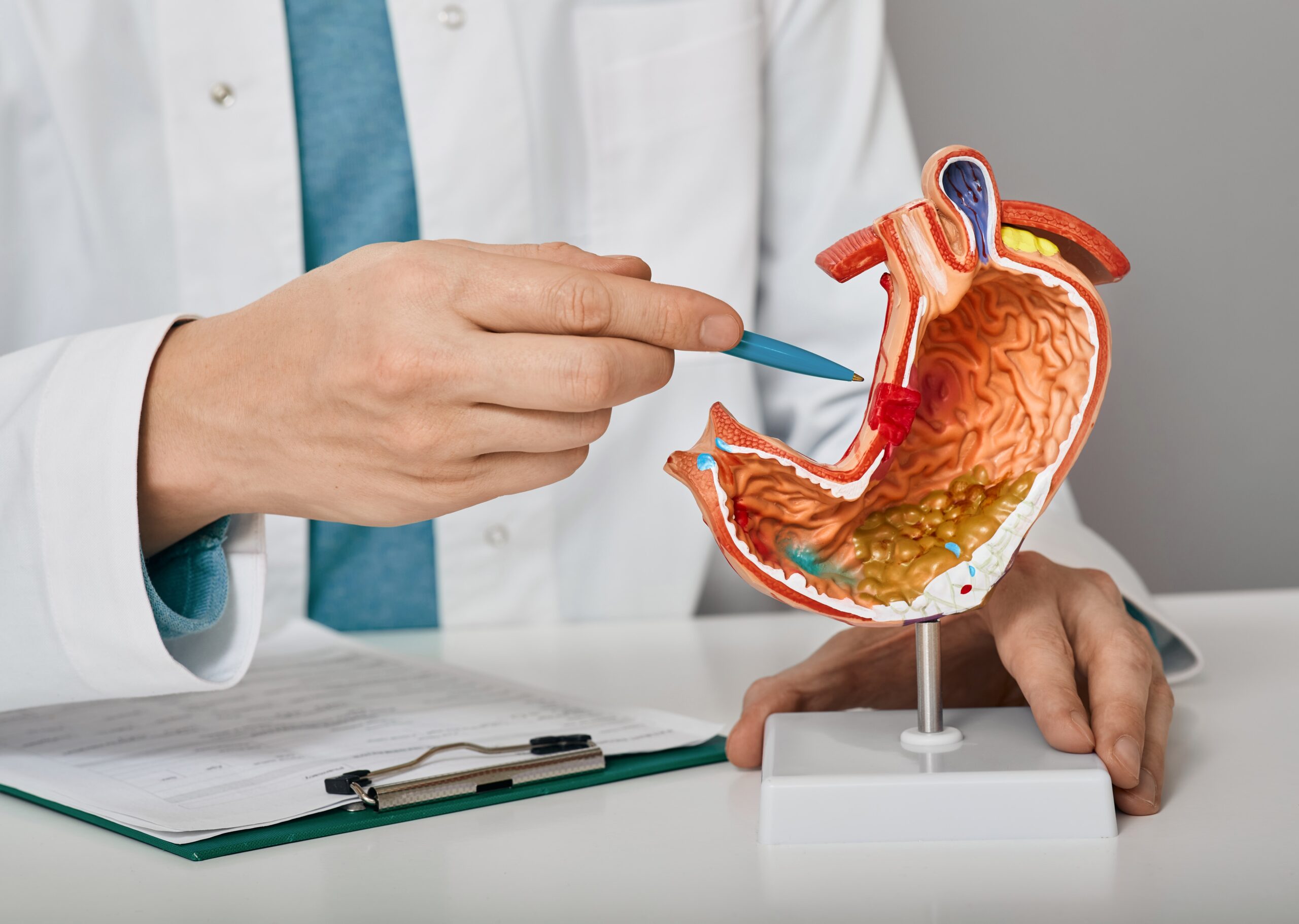Die Crux mit dem Reflux
Was hilft, wenn Medikamente nicht mehr wirken und wann eine Operation sinnvoll ist
Sodbrennen, saures Aufstoßen oder Druck hinter dem Brustbein: Refluxbeschwerden sind weit verbreitet – und werden dennoch oft unterschätzt.
Wichtig ist die Unterscheidung: Gelegentliches Sodbrennen ist meist harmlos. Von einer Refluxkrankheit (GERD) sprechen Mediziner erst, wenn die Beschwerden regelmäßig auftreten und die Lebensqualität beeinträchtigen. Dann fließt Magensäure dauerhaft zurück in die Speiseröhre – mit der Folge, dass die empfindliche Schleimhaut gereizt oder entzündet wird. Die Beschwerden können sehr belastend sein – und langfristig sogar zu ernsthaften Schäden führen.
Wenn aus Sodbrennen ein Dauerproblem wird
Gelegentliches Sodbrennen ist nicht gleich krankhaft. „Viele Menschen kennen das Brennen hinter dem Brustbein nach einem schweren Essen. Problematisch wird es, wenn die Beschwerden mehrmals pro Woche auftreten oder dauerhaft bestehen – dann sprechen wir von einer chronischen Refluxerkrankung“, erklärt Privatdozent Dr. med. habil. Boris Jansen-Winkeln, Facharzt für Viszeralchirurgie am Klinikum St. Georg. Reflux ist heute eine regelrechte Volkskrankheit, vor allem in westlichen Industrienationen. Begünstigt wird sie durch Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress sowie durch Alkohol, Nikotin oder stark gewürzte und fettige Nahrung. Auch bestimmte Medikamente können die Refluxneigung erhöhen. In vielen Fällen helfen zunächst Lebensstiländerungen – kombiniert mit Säureblockern, also Medikamenten, die die Magensäureproduktion hemmen. Doch das ist nicht immer genug. „Wenn die Beschwerden trotz Medikamenten bestehen bleiben oder wenn Patienten keine Dauermedikation wünschen, ist eine Operation oft die sinnvollste und wirksamste Alternative“, so Dr. Jansen-Winkeln.
Wenn der Magen in die Brust rutscht
Ein häufiger Grund für chronischen Reflux ist ein sogenannter Zwerchfellbruch (Hiatushernie). Dabei rutscht ein Teil des Magens aus dem Bauchraum in den Brustkorb – bei manchen Patienten sogar der halbe Magen oder mehr. „In meiner Klinik sehe ich regelmäßig Patienten mit einem sogenannten Thorax-Magen. Allein das ist bereits ein Operationsgrund, selbst ohne ausgeprägtes Sodbrennen“, sagt Dr. Jansen-Winkeln. Denn durch die Verschiebung kann der natürliche Verschlussmechanismus der Speiseröhre nicht mehr richtig funktionieren. Die Folge: Magensäure fließt ungehindert zurück – oft, ohne dass Patienten es überhaupt bemerken.
Die richtige Diagnostik ist entscheidend
Bevor operiert wird, ist eine sorgfältige Abklärung notwendig. „Zuerst muss sicher festgestellt werden, dass es sich tatsächlich um eine Refluxerkrankung handelt“, betont Dr. Jansen-Winkeln. Die Entscheidung für eine Operation erfolgt stets individuell – in enger Abstimmung mit Hausärzten und niedergelassenen Gastroenterologen. Eine Magenspiegelung liefert dabei wichtige Hinweise, etwa durch den Nachweis einer Entzündung der Speiseröhre. In bestimmten Fällen kommen ergänzend eine pH-Messung oder eine Druckmessung der Speiseröhre (Manometrie) zum Einsatz. Eine Operation ist besonders bei nachgewiesenem Zwerchfellbruch angebracht – kann aber auch ohne sichtbare Hernie sinnvoll sein, wenn die Beschwerden unter medikamentöser Behandlung fortbestehen. Wichtig ist: Vor jeder OP-Entscheidung sollte eine Magenspiegelung erfolgt sein, und es muss eine mindestens dreimonatige Behandlung mit Säureblockern stattgefunden haben. Erst wenn sich die Beschwerden darunter nicht bessern, kommt ein operativer Eingriff infrage. Denn viele Beschwerden ähneln Refluxsymptomen, haben aber andere Ursachen, etwa eine funktionelle Dyspepsie, bei denen eine Operation nicht helfen würde. Wichtig ist: Nicht alle Beschwerden im Oberbauch sind automatisch Reflux – auch ein Reizdarmsyndrom oder Bauchspeicheldrüsenerkrankungen können ähnliche Symptome verursachen.
Operation – minimal-invasiv und wirksam
Wenn die Diagnose gesichert ist und Medikamente nicht ausreichen, kann ein chirurgischer Eingriff die Beschwerden dauerhaft lindern. Am Klinikum St. Georg erfolgt dieser minimal-invasiv – über fünf kleine Hautschnitte von fünf bis zwölf Millimetern. Dabei wird der Zwerchfellbruch verschlossen und der obere Teil des Magens als Manschette um die Speiseröhre gelegt – die sogenannte Fundoplikatio nach Toupet. „Diese Manschette wirkt wie eine Barriere, die den Rückfluss verhindert, ohne das Schlucken zu beeinträchtigen“, erklärt Dr. Jansen-Winkeln. Bei Bedarf kann das körpereigene Gewebe zusätzlich mit einem spezialisierten Kunststoffnetz verstärkt werden. Für Patienten mit kleinerem Zwerchfellbruch und ohne schwerwiegende anatomische Veränderungen gibt es zudem eine moderne Alternative: das sogenannte LINX-Band. Dabei handelt es sich um ein kleines Magnetband, das den Übergang zwischen Speiseröhre und Magen locker verschließt und sich beim Schlucken automatisch öffnet. „Wir setzen dieses Verfahren bei ausgewählten Patienten ein, bei denen eine klassische Manschette nicht notwendig oder gewünscht ist.“
Reflux ist nicht harmlos
Wird eine chronische Refluxerkrankung nicht behandelt, kann sich die Schleimhaut der Speiseröhre dauerhaft verändern. Die sogenannte Barrett-Metaplasie gilt als Vorstufe von Speiseröhrenkrebs, eine seltene, aber ernstzunehmende Folge. Eine konsequente Therapie ist daher wichtig – sei es medikamentös oder operativ. „Die Operation ist kein Routineeingriff, aber in erfahrenen Händen mit geringen Risiken verbunden“, sagt Dr. Jansen-Winkeln. Schluckbeschwerden nach dem Eingriff sind selten und meist nur vorübergehend. Die wichtigste Erkenntnis: Nicht jedes Sodbrennen ist krankhaft. Aber wer regelmäßig Beschwerden hat, sollte sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nach einer gesicherten Diagnose und dem Scheitern medikamentöser Behandlung kann eine Operation helfen, dauerhaft beschwerdefrei zu leben – ganz ohne tägliche Tabletten. ■
Typische Symptome:
- Brennendes Gefühl hinter dem Brustbein (Sodbrennen)
- Saures Aufstoßen
- Völlegefühl oder Druck im Oberbauch
- Chronischer Husten, Heiserkeit, Räusperzwang
- Kehlkopfentzündungen oder Reizhusten ohne erkennbare Ursache
Was Sie selbst tun können:
- Gewicht reduzieren, wenn Übergewicht besteht
- Fettreiche, scharfe und stark gewürzte Speisen meiden
- Auf Alkohol, Nikotin und kohlensäurehaltige Getränke möglichst verzichten
- Kleine Mahlzeiten statt großer Portionen einnehmen
- Späte Abendmahlzeiten vermeiden – besser drei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr essen
- Oberkörper beim Schlafen leicht hochlagern
- Regelmäßige Bewegung hilft – Stressreduktion auch