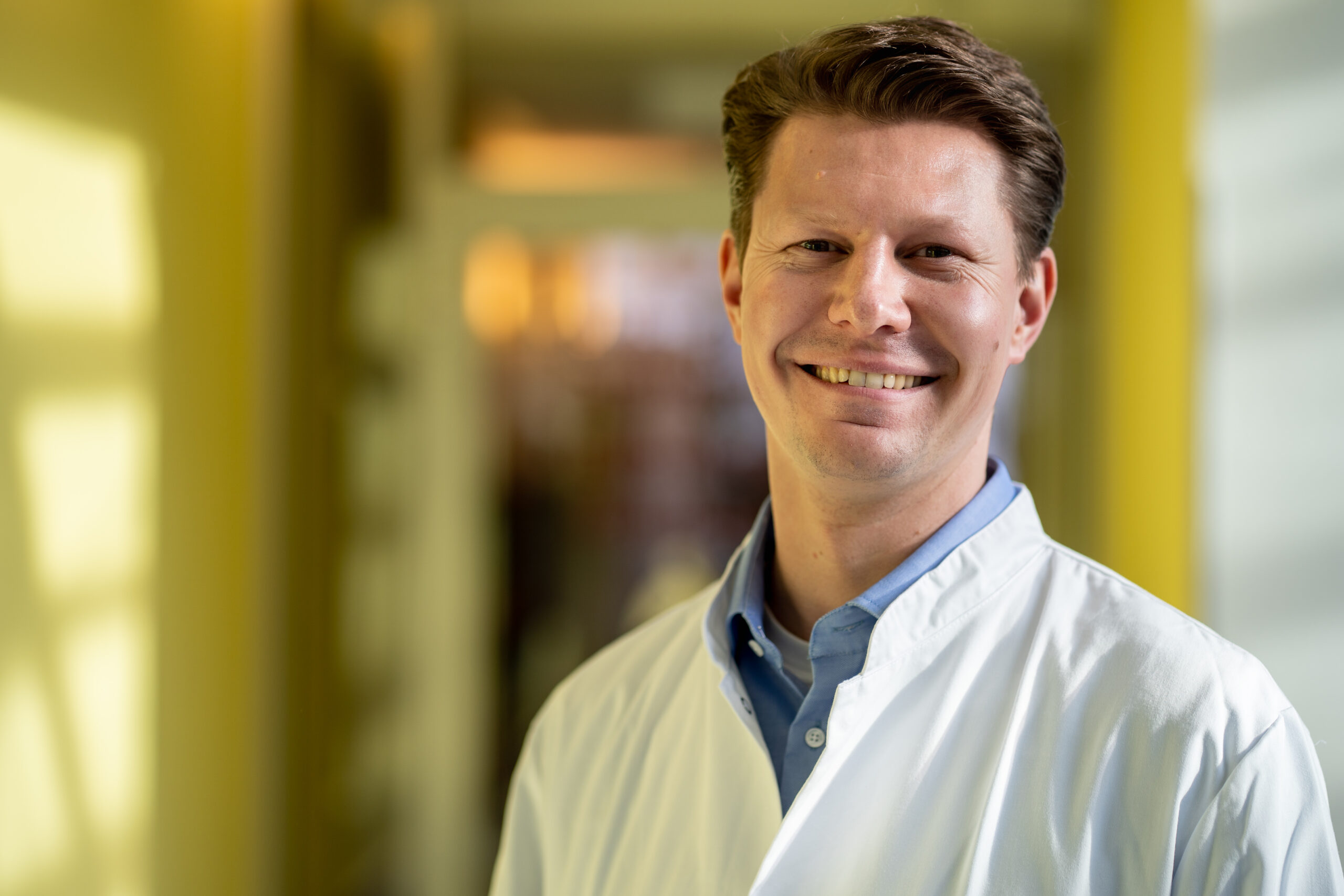Immundefekte erkennen und behandeln
Spurensuche am ImmunDefektCentrum Leipzig (IDCL) des Klinikums St. Georg
Infektionen, die ungewöhnlich häufig auftreten, lange anhalten oder schwer verlaufen – viele Menschen kennen das Gefühl, dass hinter den Beschwerden mehr stecken könnte. In einigen Fällen bestätigt sich der Verdacht: Das körpereigene Abwehrsystem funktioniert nicht, wie es sollte. Bei angeborener Immundefizienz ist das Immunsystem dauerhaft geschwächt – mit vielfältigen Auswirkungen auf Gesundheit und Alltag.
„Die Symptome sind meist unspezifisch“, erklärt Dr. Maria Faßhauer, Oberärztin am ImmunDefektCentrum Leipzig (IDCL). „Patienten berichten von wiederkehrenden Infektionen, geschwollenen Lymphknoten oder chronischen Beschwerden wie Durchfall. Manche Kinder nehmen nicht ausreichend an Gewicht zu, teilweise gibt es bereits Auffälligkeiten in der Familienanamnese.“ Oft sei der Weg zur Diagnose lang – umso wichtiger sei eine strukturierte und interdisziplinäre Abklärung.
Die Arbeit beginnt mit genauer Beobachtung
Die Bandbreite an Symptomen ist groß – von häufigen Mittelohrentzündungen bis zu schwer verlaufenden Lungenentzündungen. „Es geht uns nicht darum, unnötige Sorgen zu machen“, betont Dr. Stephan Borte, Ärztlicher Leiter des IDCL. „Aber wenn Beschwerden wiederkehren oder ungewöhnlich verlaufen, lohnt sich ein genauer Blick auf das Immunsystem.“ „Bei der Diagnostik folgen wir einem Stufenmodell“, erläutert Dr. Borte. Erste Hinweise liefern meist die Hausärzte oder der Kinderarzt – etwa durch ein großes Blutbild und Bestimmung der Immunglobuline sowie eine ausführliche Anamnese. Wenn sich der Verdacht erhärtet, kommen spezielle Untersuchungen im IDCL hinzu, zum Beispiel die durchflusszytometrische Analyse der Lymphozytensubpopulationen, die Überprüfung von Impf-Antikörpern oder weiterführende funktionelle Tests.
Diagnostik, Therapie, Begleitung –alles an einem Ort
Die besondere Stärke des IDCL liegt in der engen interdisziplinären Zusammenarbeit: Fachärzte aus der Pädiatrie und der Inneren Medizin – etwa aus der Infektiologie, Pneumologie, Rheumatologie, Hämato-Onkologie, Nephrologie und Gastroenterologie arbeiten Hand in Hand – unterstützt durch moderne Labormedizin, Radiologie und Pathologie. „Eine Immundefizienz kann sich an verschiedenen Organsystemen zeigen“, betont Dr. Faßhauer. „Deshalb braucht es ein Team, das über den Tellerrand hinausblickt.“ In der immunologischen Institutsambulanz (§116b) werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit seltenen Immundefekten kontinuierlich betreut – auf Überweisung. „Gerade junge Erwachsene finden oft nach dem 18. Geburtstag schwer spezialisierte Ansprechpersonen“, sagt Dr. Faßhauer. „Bei uns bleiben sie lückenlos in guten Händen.“ Auch gemeinsame Termine für mehrere Familienmitglieder sind möglich – das spart Wege und vereinfacht die Koordination.
Perspektiven aufzeigen
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein zehnjähriger Junge kommt mit einer längeren Vorgeschichte mit häufigen Infektionen, Lungenentzündungen und chronischem Durchfall in die Ambulanz. Die ausführliche Anamnese und ergänzende Laboruntersuchungen führen zur Diagnose eines Antikörper-Mangelsyndroms. Die Behandlung erfolgt mit regelmäßiger Immunglobulin-Ersatztherapie – anfangs in der Klinik, später in Heimselbsttherapie. Schon nach wenigen Monaten verbessert sich der Gesundheitszustand deutlich: weniger Infektionen, Verbesserung des Gewichts, mehr Energie, weniger Fehlzeiten in der Schule. „Solche Entwicklungen zeigen, wie wirksam unsere Arbeit ist“, so Dr. Faßhauer. „Wenn wir durch Erfahrung, Teamarbeit und moderne Technik dazu beitragen können, dass ein Kind wieder lachen und spielen kann – dann hat sich jede Mühe gelohnt.“
Dr. Borte ergänzt: „Unser Ziel ist es, Menschen mit seltenen Erkrankungen nicht allein zu lassen. Wir wollen ihnen Perspektiven geben – fachlich fundiert, menschlich zugewandt und auf lange Sicht.“
Früherkennung kann Leben retten
Seit August 2019 besteht in Deutschland flächendeckend ein Neugeborenen-Screening auf SCID (severe combined immunodeficiency) und andere schwere T-Zell-Immundefizienzen und ist damit auch Bestandteil des Neugeborenenscreenings am Klinikum St. Georg. Dabei werden T-Zellen nachgewiesen, die für eine funktionierende Immunabwehr essenziell sind. Fehlen sie, kann frühzeitig eine lebensrettende Behandlung, etwa eine Stammzelltransplantation, eingeleitet werden. „Unbehandelt versterben betroffene Kinder meist innerhalb der ersten Lebensjahre“, so Dr. Borte. „Dank der frühzeitigen Diagnose haben sie heute sehr gute Überlebenschancen.“
Leben mit einer chronischen Erkrankung
Wie sich ein Immundefekt auf das Leben auswirkt, ist individuell verschieden. „Die Ausprägung ist von der Art der immunologischen Störung abhängig und kann auch innerhalb einer Familie variieren.“ Viele führen mit der richtigen medizinischen Behandlung ein weitgehend normales Leben. „Nach der Diagnose erleben viele Familien eine gewisse Erleichterung“, berichtet Dr. Faßhauer. „Häufig liegt eine lange Phase der Unsicherheit hinter ihnen – jetzt wissen sie, was los ist.“ Neben der medizinischen Betreuung arbeitet das IDCL eng mit der Patientenorganisation dsai zusammen. Es gibt Schulungen, Austauschmöglichkeiten und Informationsangebote für Betroffene und Angehörige. „Wissen gibt Sicherheit“, betont Dr. Borte. „Wenn Familien verstehen, was im Körper passiert, gehen sie gestärkt mit der Situation um.“ ■